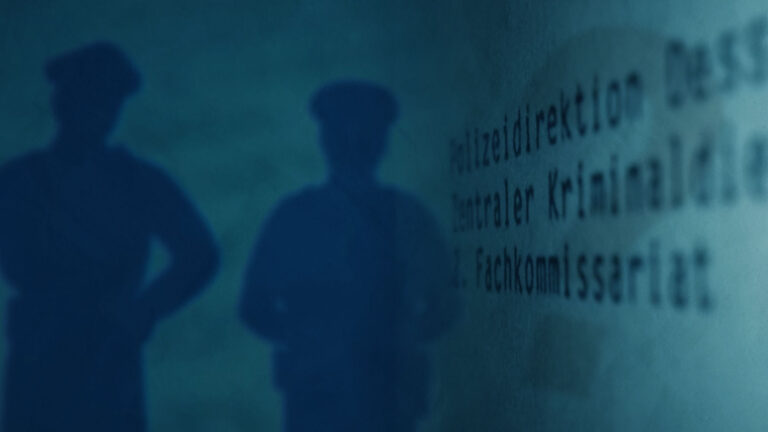Seit Monaten liegt die Strafanzeige der Familie von Jürgen Rose und des Recherche-Zentrums bei der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt, ohne öffentlich kommunizierte Maßnahmen. Familie Rose hält diese nach wie vor für befangen. Das Recherche-Zentrum zeigt in diesem Artikel auf, dass die Ermittlungen von Anfang an fragwürdig liefen.
Die Akten zum Tod von Jürgen Rose zeigen keinen geradlinigen Weg zur Wahrheit, sondern drei Phasen eines Vertuschungsmechanismus. Phase I verändert in den ersten, entscheidenden Stunden Chronologie und Beweisgrundlage im Polizeirevier Dessau. Phase II bringt in wenigen Tagen eine belastbare Linie: Misshandlung als Ursache, Spuren im Speisesaal, mögliche Tatwerkzeuge und medizinische Checks. Phase III verlagert den Fokus weg von der Nachtschicht und hin zu Unbeteiligten. Das lässt die zentrale Spur unermittelt zurück.
Als Jürgen Rose am 7. Dezember 1997 schwer verletzt vor einem Wohnblock in der Dessauer Wolfgangstraße gefunden wurde, lag der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen nahe. Er starb am Morgen des 8. Dezember an den Folgen massiver Verletzungen. Dr. Uta Romanowski, die den Leichnam obduzierte, sagte im Interview mit dem Recherche-Zentrum rückblickend, der Fall stelle sich „als Bild einer Misshandlung“ dar.
Phase I: Interne Ermittlungen und erste Manipulationen
Die ersten drei Tage der Ermittlungen lagen beim Revierkriminaldienst des Polizeireviers Dessau. In dieser Zeit wurde die Staatsanwaltschaft nach Aktenlage trotz Anzeige aus dem Klinikum nicht eingebunden. Ein Beamter der Frühschicht meldete laut Akte unmittelbar verdächtige Aussagen aus den Reihen der Nachtschicht und schilderte das auffällige Verhalten zweier Kollegen, die Rose zuvor ins Revier gebracht hatten und ihn am Fundort nicht erkannt haben wollten.
Durch diese Aussagen scheint es in dieser Phase einen erheblichen internen Druck gegeben zu haben. Denn das forensische Gutachten von John Welch belegt, dass im Lagefilm alle Uhrzeiten bezüglich Jürgen Rose mit Tipp-Ex überdeckt und neu eingetragen wurden. Die zentralen Dokumente wurden also nachweislich bearbeitet. So entstand der Eindruck, Jürgen Rose habe das Revier unverletzt verlassen.
In dieser Anfangsphase, am mutmaßlichen Tatort selbst, fand nicht nur die Verschleierung der Chronologie statt. Auch mit den Asservaten gab es einen fragwürdigen Umgang.
Nach Aktenlage wurden im Krankenhaus Dessau 11,50 DM aus der Hose von Jürgen Rose gesichert. Drei Jahre später verzeichnet das LKA 940 DM in denselben Hosentaschen. Da das Asservat in der Zwischenzeit ausschließlich in behördlicher Verwahrung war, muss der höhere Bargeldbetrag nachträglich von einer zugriffsberechtigten Person in die Hose gelangt sein. Einen detaillierten Artikel zum Thema gibt es hier. Ein schwer zu erklärender Umstand, den selbst die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Anwalt der Familie in einem Schreiben als erklärungsbedürftig bezeichnete.
Diese Phase zeigt, wie die Ermittlung bereits am Anfang auf Abwege geriet. Nicht die umfassende Spurensicherung stand im Vordergrund, sondern die zielgerichtete Veränderung zentraler Dokumente und das Unter-Druck-Setzen des einzigen Belastungszeugen.
Phase II: Kurzer Moment ernster Aufklärung
Am 10. Dezember 1997 übernahm das Fachkommissariat 2 der Polizeidirektion Dessau. In nur wenigen Tagen wurden mehrere Schritte angestoßen. Der Ermittlungsleiter P. veranlasste nun eine Obduktion und besprach sich mit der Staatsanwaltschaft. P. sah sehr schnell, worauf es in diesem Fall ankam, denn die Rechtsmedizin lieferte einen klaren Befund. Das Verletzungsbild passte nicht zu Unfall oder Fenstersturz. Es ließ sich nur als Folge massiver Gewalt erklären.
Auch agierten P. und seine Ermittler, was die möglichen Verdächtigen betraf. Spuren im Revier wurden gesichert. Der Speisesaal des Polizeireviers wurde kriminaltechnisch untersucht, da dies der „Aufenthaltsort des Rose“ gewesen sei. Ein aktenkundiger Hinweis, der diese Fokussierung erklärt, liegt jedoch nicht vor. Doch da war für P. noch nicht Schluss: Schlagstöcke und Handfesseln aus der Nachtschicht wurden erfasst, weil sie als Tatwerkzeuge infrage kamen, und Beamte wurden medizinisch auf Abwehrverletzungen untersucht.
In wenigen Tagen zeichnete sich eine konsistente Richtung ab. Sie führte zu den Beamten, die Jürgen Rose festgenommen hatten. Ausgerechnet in diesem Moment veränderte sich jedoch die Tonlage der Ermittlungen, als die Staatsanwaltschaft um die vollständige Akte bat.
Kurz darauf legte der leitende Ermittler einen Sachstandsbericht vor. Darin galten zuvor verworfene Hypothesen plötzlich als „vorschnell […] ausgeschlossen“. Die zuvor geplanten Vernehmungen wurden verschoben und die beiden Hauptverdächtigen wurden, zumindest nach Aktenlage, gar nicht befragt.
Diese Phase ist der Zeitraum, in dem Aufklärung noch möglich scheint. Warum die Ermittlungen hier ausgebremst wurden, bleibt unklar. Das Gesamtbild spricht weniger für Beweismangel als für eine Reaktion auf äußeren Druck. Die Frage liegt nahe, ob die Ermittler ihre eigenen Ergebnisse nicht weiterverfolgen durften.
In diese Phase fällt ein Satz, den Iris Rose, die Witwe von Jürgen Rose, von dem Ermittler P. gehört hat. Eines Tages, während eines Gesprächs, teilte er ihr mit: „Sie wüssten auch, wer diese Täter sind, aber sie könnten dagegen nichts machen.“
Phase III: Verschleierung und schleichender Stillstand
Nach dem erwähnten Sachstandsbericht vom 18. Dezember verschob sich der Fokus weg von Beamten der Nachtschicht und auf Menschen, die mit dem Tod von Jürgen Rose nichts zu tun hatten. Der Anwohner, der den Notruf absetzte, wurde stundenlang vernommen, ohne anwaltliche Begleitung. Er ging natürlich davon aus, dass er als Zeuge geladen war. Stattdessen wurde er, nach eigener Aussage, dazu gedrängt, sich selbst zu belasten. Die Gardinenstange aus dem Kinderzimmer wurde als mögliches Tatwerkzeug konfisziert.
Die Befragungen der Beamten hingegen, die vorher als Verdächtige galten, waren nun kollegial und kurz. Die beiden Beamten, die mit Jürgen Rose am meisten zu tun hatten, wurden laut Akte nicht befragt. Die Auswertung des möglichen Tatorts im Revier dauerte lange und ergab nichts. Stattdessen fokussierte man sich auf die kriminaltechnische Untersuchung des Wohnhauses, vor dem er gefunden wurde. Es konnte, trotz intensiver Untersuchung, keine Spur von Jürgen Rose gefunden werden.
Der Aktenberg wuchs, die Dynamik ging verloren, eine konsequente Untersuchung belastender Spuren unterblieb.
Am Ende dieser Phase standen über tausend Seiten Ermittlungsakte – mit offenen Spuren, aber ohne entlastende Erkenntnisse. Dafür jedoch mit gutachterlich belegten Manipulationen an zentralen Unterlagen und mit vielen offenen Fragen für die Familie von Jürgen Rose.
Der Vorgang wirkt nicht wie ein Scheitern an der Beweislage, sondern wie eine Verlagerung der Ermittlungsrichtung. Anstatt dieser Linie mit der nötigen Konsequenz nachzugehen, wurden realitätsferne Hypothesen priorisiert. Die Konsequenz ist in den Akten ablesbar: Man kann sich nicht erklären, was mit Jürgen Rose geschehen ist. Das Verfahren wurde eingestellt.
Die offene Frage:
Solange keine Schritte öffentlich werden, bleibt der in den Akten sichtbare Mechanismus wirksam und die entscheidende Frage unbeantwortet: Wer hat Jürgen Rose gefoltert und ihn in der Wolfgangstraße zum Sterben abgelegt?